Die beste Heizung für den Altbau
Zuletzt aktualisiert am 11.8.2025
Lesedauer: 10 Minuten
Das Gebäudeenergiegesetz verlangt, dass neu eingebaute Heizungen anteilig mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Lesen Sie hier, wie Besitzer:innen von Altbauten diese Pflicht erfüllen können.
Welche Heizung ab 2025
Hausbesitzer:innen dürfen ihre bestehende Öl- oder Gasheizung nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG), auch Heizungsgesetz genannt, noch bis 2045 weiter betreiben. Die Voraussetzung: Die Anlage arbeitet mit Niedertemperatur- oder Brennwerttechnik. Ist das nicht der Fall, müssen Sie als Eigentümer:in eine neue Heizung installieren, sobald diese 30 Jahre in Betrieb ist. Einzige Ausnahme: Heizungen in Ein- oder Zweifamilienhäusern, die von den Eigentümer:innen schon seit Februar 2002 oder länger bewohnt werden. Doch unabhängig davon, ob Eigentümer:innen gesetzlich zum Einbau einer neuen Heizung verpflichtet sind oder nicht: Bei älteren, ineffizienten Anlagen ist der Austausch wirtschaftlich meist immer sinnvoll – und aus Klimasicht ohnehin.

Das Energielabel der Heizung ist eine Entscheidungshilfe, wenn es darum geht, ob eine alte Heizung ausgetauscht werden soll. Das Label ist auf allen Heizungen zu finden, die älter als 15 Jahre sind. Es zeigt auf einen Blick, wie effizient ein Gerät im Vergleich zu allen anderen auf dem Markt erhältlichen Modellen arbeitet. Dargestellt wird die Effizienz anhand einer Skala, die von A+++ bis D reicht. Laut Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) gilt eine Heizung der Klasse C als so ineffizient, dass sie zeitnah ausgetauscht werden sollte.
Gut zu wissen: Wenn Ihre Heizung kein Energielabel trägt, können Sie die Effizienzklasse mit einem Online-Rechner des BMWK selbst ermitteln. Dafür benötigen Sie allerdings einige technische Angaben zu Ihrer Heizung.
-
Wie hoch ist mein Budget?
-
Sind energetische Sanierungsmaßnahmen energetische Sanierungsmaßnahmen geplant (zum Beispiel Dämmung)?
-
Welche Heizleistung wird benötigt?
-
Wie wird die Wärme im Haus verteilt?
-
Soll die Heizung komplett modernisiert werden oder ist nur ein Austausch von Komponenten geplant?
-
Welche Förderungen kann ich nutzen?

Auf jeden Fall stehen bei der Modernisierung einer Heizungsanlage im Altbau viele Optionen zur Auswahl, um die 65-Prozent-Vorgabe des Heizungsgesetzes in Zukunft zu erfüllen.
Wärmepumpe – Vor- und Nachteile im Altbau
Wärmepumpen arbeiten effizient, sie sind wirtschaftlich und klimafreundlich – auch in den meisten Altbauten. Das gilt vor allem für Gebäude, die ab 2003 errichtet wurden. Denn diese Häuser sind bereits nach einem hohen energetischen Standard gebaut worden.
Doch auch für viele ältere Gebäude eignen sich Wärmepumpen gut – vor allem, wenn sie schon einmal energetisch saniert wurden, etwa mit einer nachträglichen Fassadendämmung. Allerdings kann es mitunter sinnvoll sein, vor der Installation einzelne Heizkörper durch solche mit größerer Oberfläche zu ersetzen. Dann wird das Haus nämlich auch mit niedrigeren Vorlauftemperaturen gemütlich warm, sodass die Wärmepumpe weniger Leistung erbringen muss und damit weniger Strom benötigt. Bei Gebäuden in mäßigem energetischen Zustand ist es für den effizienten Betrieb einer Wärmepumpe zudem notwendig, einige Sanierungsmaßnahmen umzusetzen. Dazu zählen etwa die Dämmung der obersten Geschoss- sowie der Kellerdecke oder der Einbau neuer Fenster.
Für Anschaffung und Einbau einer Luft-Wasser-Wärmepumpe müssen Eigentümer:innen ohne Förderung mit Kosten von circa 25.000 bis 45.000 € rechnen, bei Erdwärmepumpen sind es rund 28.000 bis 52.000 €. Einen Teil der Kosten übernimmt der Bund. Wärmepumpen sind damit in der Anschaffung teurer als Gasheizungen, dafür schlagen sie die fossilen Kessel bei den Betriebskosten.
Die Agora-Studie „Durchbruch für die Wärmepumpe“ belegt, dass die laufenden Kosten einer Wärmepumpe selbst im unsanierten Altbau unter denen einer Gasheizung liegen. Wenn man die staatliche Förderung für den Einbau erneuerbarer Energien noch mit einbezieht, rechnet sich die Wärmepumpe bereits nach weniger als zehn Jahren. Wenn die Wärmepumpe zusätzlich mit Strom aus der eigenen Photovoltaikanlage versorgt werden kann, geht es sogar noch schneller.
Detaillierte Informationen zu dieser Heiztechnologie geben wir Ihnen in unserem Artikel „Wärmepumpen im Altbau“. Dort stellen wir Ihnen auch ein einfaches Verfahren vor, mit dem Sie ermitteln können, ob eine Wärmepumpe für Ihr Einfamilienhaus infrage kommt und mit welchen Stromkosten Sie rechnen müssen.
Vorteile:
-
Hohe staatliche Förderung von bis zu 70 % der Kosten
-
Vergleichsweise geringe Betriebskosten, da die Anlagen sehr effizient arbeiten. Das gilt umso mehr auf mittlere und lange Sicht, da bei Strom im Gegensatz zu den Brennstoffen für Gas- und Ölkessel keine Preissprünge zu erwarten sind.
-
Geringe Wartungskosten. Zudem entfallen die Kontrollen durch die Kaminkehrer:innen.
-
Wärmepumpen lassen sich bestens mit Photovoltaik-Anlagen kombinieren. An sonnigen Tagen können Solarsysteme häufig einen großen Teil des Strombedarfs der Wärmepumpe decken.
Nachteile:
-
Höhere Anschaffungskosten als bei einer Gas- oder Ölheizung
-
Je nach Art der Wärmepumpe vergleichsweise hoher Platzbedarf: Luft-Wasser-Wärmepumpen haben eine Außeneinheit, die etwa ein bis zwei Quadratmeter Fläche auf dem Grundstück beansprucht. Erdwärmepumpen erfordern Bohr- oder Erdarbeiten.
-
Geräuschentwicklung durch die Außeneinheit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe
-
Viele Wärmepumpen-Modelle enthalten geringe Mengen an Kältemitteln, die klimaschädlich wirken, wenn sie in die Umwelt entweichen.
-
Die Installation verlangt den Durchbruch der Gebäudehülle. Bei nicht fachgerechtem Vorgehen können dadurch Kälte und Feuchtigkeit eindringen.
Sie möchten es ganz genau wissen?
Rechnen Sie selber nach. Mit dem Kostenplaner. Erfahren Sie, ob sich eine Luft-Wasser-Wärmepumpe für Ihr Haus rechnet:
-
Gesamtkosten im Blick: Alle Kosten im Detail erklärt inkl. 2 echter Beispiele (Öl und Gas)
-
Max. Förderung: Was, wie, von wem gefördert wird und wie Sie die höchsten Summen sichern
-
Stromkosten berechnen: Einfache Anleitung zur Berechnung Ihrer Betriebskosten mit Wärmepumpe
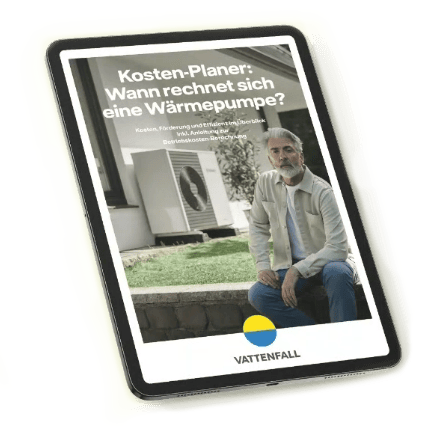
Hybridheizungen – Vor- und Nachteile im Altbau
Ein Hybridheizung kann eine passende Lösung für einen schlecht gedämmten Altbau sein. Diese Systeme bestehen aus zwei Heiztechnologien, etwa einem bestehenden Gas- oder Ölkessel und einer neuen Wärmepumpe. Der fossile Kessel unterstützt die Wärmepumpe, wenn die Außentemperatur sehr niedrig ist. Das spart Strom, weil die Wärmepumpe so effizienter arbeiten kann. Ebenso lassen sich Solarthermie-Anlagen, Biomasse-Kessel oder Brauchwasserwärmepumpen mit bestehenden Gas- oder Ölkesseln koppeln. Es gibt auch Kombinationen rein aus erneuerbaren Energien.
Einige Heiztechnik-Hersteller bieten zudem Hybrid-Komplettsysteme mit neuem Erdgas-Brennwertkessel und Wärmepumpe an. Da hier zwei Technologien verbaut sind, liegen die Kosten deutlich über denen einer Luft-Wasser-Wärmepumpe, die als alleinige Heizung eingesetzt wird. Hausbesitzer:innen müssen hier mit Kosten von etwa 20.000 bis 45.000 € rechnen. Sie werden von der KfW mit bis zu 70 % Zuschuss gefördert, bezogen auf Kosten von bis zu 30.000 €. Bei der Berechnung der Fördersumme werden allerdings nur die Kosten berücksichtigt, die auf die Wärmepumpen-Technik entfallen. Grundsätzlich sollte im Einzelfall geprüft werden, welche Hybrid-Anwendung für das jeweilige Gebäude am geeignetsten ist.
Vorteile:
-
Auch für Altbauten in schlechtem energetischen Zustand geeignet
-
Deutlich klimafreundlicher als eine reine Erdgas-Heizung, da der Brennwertkessel nur an sehr kalten Tagen genutzt wird
-
Flexibles Heizen: Haushalte sind weit weniger betroffen von steigenden Kosten für fossile Brennstoffe
-
Ganzjährig hocheffizienter Betrieb der Wärmepumpe, da sie bei Bedarf durch die ergänzende Heiztechnologie unterstützt wird
Nachteile:
-
Höhere Anschaffungs- und Wartungskosten durch den Einbau von zwei Heizsystemen
-
Zwei Heizsysteme bedeuten ein größeres Risiko für Störungen
-
Die Steuerung des Hybridsystems ist anspruchsvoll. Stimmt die Einstellung nicht, entstehen unnötig hohe Energiekosten
-
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen bleibt bestehen
Gasbrennwertanlagen – Vor- und Nachteile im Altbau
Betrachtet man allein den Anschaffungspreis, ist ein moderner Gasbrennwertkessel die kostengünstigste Option beim Heizungstausch. Für Altbauten eignet er sich rein technisch gesehen bestens. Im Vergleich zu einer alten Heizung kann ein neuer Kessel mit demselben Brennstoff für Einsparungen von bis zu 30 % sorgen. Die Investitionskosten liegen zwischen 15.000 und 25.000 €. Von wenigen Ausnahmen abgesehen werden die Anlagen nicht gefördert.
Betrachtet man allerdings die gesamte Lebenszeit der Heizung, schneiden Gaskessel wirtschaftlich schlecht ab, da der Brennstoff in den nächsten Jahren unter anderem wegen der europäischen CO2-Bepreisung sehr teuer werden wird.
Seit Anfang 2024 dürfen in Altbauten nur Gasheizungen eingebaut werden, die künftig einen Mindestanteil an erneuerbaren Energien nutzen. Für eine Übergansphase gilt: 2029 liegt die Quote bei 15 %, 2035 bei 30 % und 2040 bei 60 %. Ab 2045 müssen alle Gasheizungen komplett klimaneutral arbeiten. In Kommunen mit mehr als 100.000 Einwohnern endet diese Übergangsphase spätestens am 30. Juni 2026, in kleineren Kommunen am 30. Juni 2028. Gasheizungen, die nach diesen Stichtagen eingebaut werden, müssen von Beginn an zu 65 % mit erneuerbaren Energien – also mit Biogas oder grünem Wasserstoff – betrieben werden.
Die meisten der aktuell verkauften Gasheizungen kommen problemlos mit der Beimischung von 20 % Wasserstoff im Erdgas zurecht, manche auch mit 30 %. Die Heizungsindustrie entwickelt derzeit Anlagen, die standardmäßig mit Erdgas arbeiten, später jedoch auf den Betrieb ausschließlich mit Wasserstoff umgerüstet werden können („H2 ready“).
Vorteile:
-
Niedrige Anschaffungskosten
-
Etablierte Technologie, viele Haushalte sind mit dem Heizungssystem und dem Brennstoff vertraut
-
Gasbrennwertheizungen eignen sich für sämtliche Altbauten, unabhängig von ihrem energetischen Zustand
-
Installationsbetriebe verfügen in der Regel über sehr viel Erfahrung mit der Technologie
Nachteile:
-
Steigende Verbrauchskosten durch stetig steigende CO2-Preise
-
Seit Januar 2024 greift auch hier die Erneuerbare-Energien -Regel: künftig nur noch legitim bei Nutzung grüner Gase
-
Vergleichsweise hohe CO2-Emissionen
-
Manche Kommunen haben bereits angekündigt, ihr Gasnetz mittelfristig stillzulegen. Viele weitere werden folgen. Eigentümer:innen mit Gasheizung müssen dann auf eine andere Technologie umsteigen, unabhängig vom Alter ihrer Anlage
Holzpellet-Heizungen – Vor- und Nachteile im Altbau
Pelletheizungen eignen sich gut für Altbauten, auch für solche ohne oder nur mit dünner Dämmung, da sie ein hohes Temperaturniveau erreichen. Einzige Bedingung für die Installation einer solchen Anlage: Es muss einen geeigneten Raum für das Lagern des Brennstoffs geben. Die Anlagen werden als nachhaltig beworben, weil die heimischen Pellethersteller fast ausschließlich Restholz aus der Sägeindustrie verwenden.
Pelletheizungen verbrennen aus Spänen oder Sägemehl gepresste Holzstäbchen unter kontrollierten Bedingungen. Im Vergleich zu einem klassischen Kamin erreichen Pelletheizungen einen viel höheren Wirkungsgrad – sie nutzen den Brennstoff also effizienter. Die Verbrennung läuft automatisch, ein Nachlegen von Holz – wie beim Kamin – ist nicht notwendig.
Die Anschaffungskosten liegen mit 25.000 bis 40.000 € ähnlich hoch wie bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe. Auch hier übernimmt der Bund bis zu 70 % der Kosten. In den vergangenen Jahren waren die Brennstoffe weit günstiger als Erdgas und Heizöl.
Vorteile:
-
Niedrige Brennstoffkosten
-
Haushalte können beim Einkauf der Pellets gezielt Phasen niedriger Preise nutzen, da sich der Brennstoff gut lagern lässt
-
Pellets gelten gesetzlich als erneuerbare Energiequelle, erfüllen also die 65-Prozent-Vorgabe des Heizungsgesetzes
-
Staatliche Förderung von bis zu 70 % der Kosten
Nachteile:
-
Vergleichsweise hohe Anschaffungskosten
-
Das Heizungssystem muss regelmäßig vom Kaminkehrer überprüft werden, was Kosten verursacht
-
Ausreichend geeigneter Lagerraum muss vorhanden sein
-
Feinstaub-Belastung weit höher als bei Gasheizungen
-
Umwelt- und Klimaschützer betrachten Holz nicht als nachhaltigen Brennstoff – unter anderem, weil sie das in der Biomasse gespeicherte CO2 wieder freisetzen und so die positive Klimawirkung der Bäume zum Teil zunichtemachen
Fernwärme – Vor- und Nachteile im Altbau
Fernwärme ist für Eigentümer:innen die komfortabelste Option, da der Versorger die Wärmeerzeugung übernimmt. Dieser ist dafür verantwortlich, dass die Klimaschutzvorgaben eingehalten werden. Über ein Leitungsnetz transportiert er die Heizenergie zu den Verbraucher:innen. Fernwärme ist für alle Gebäude eine gute Lösung, unabhängig vom Sanierungszustand. Der Investitionsbedarf ist vergleichsweise gering, da lediglich ein Hausanschluss eingerichtet werden muss. Dafür entstehen Kosten von 5.000 bis 12.000 €. Stammt die Fernwärme zu mindestens 75 % aus erneuerbaren Quellen oder aus industrieller Abwärme, können Eigentümer:innen einen Zuschuss von bis zu 70 % der förderfähigen Kosten in Anspruch nehmen.
Viele Kommunen wollen bestehende Fernwärmenetze in den nächsten Jahren deutlich ausbauen und auch neue Netze schaffen. Das Heizungsgesetz verlangt von Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern, bis zum 30. Juni 2026 einen Wärmeplan vorzulegen, der unter anderem Auskunft darüber gibt, wo künftig Gebäude an ein Wärmenetz angeschlossen werden können. Kleinere Kommunen haben dafür bis zum 30. Juni 2028 Zeit. Wer seine Heizung erneuern will, sollte sich also informieren, ob vor Ort der Neu- oder Ausbau eines Wärmenetzes geplant ist, an das das Gebäude angeschlossen werden könnte.
Vorteile:
-
Für alle Altbauten geeignet
-
Hoher Komfort, da sich die Eigentümer:innen nicht selbst um die Wärmeerzeugung kümmern müssen
-
Geringe Investitionskosten
-
Keine Wartungskosten, keine Kontrollen durch den Schornsteinfeger
-
Mehr Platz im Keller, da keine eigene Heizungsanlage und kein Pelletlager notwendig ist
Nachteile:
-
Längst nicht überall verfügbar
-
Bindung an den Fernwärme-Versorger, keine Möglichkeit zum Anbieterwechsel
-
Mancherorts hohe Wärmekosten
-
Keinen Einfluss auf die Emissionen der Wärmeerzeugung
Klimageräte – Vor- und Nachteile im Altbau
Ein Klimagerät funktioniert nach demselben physikalischen Prinzip wie eine Wärmepumpe. Es nutzt die Wärmeenergie der Außenluft und erzeugt je nach Bedarf Wärme oder Kälte, um die Raumluft zu beheizen oder zu kühlen. Klimageräte können ausschließlich zur Raumheizung eingesetzt werden, nicht jedoch zur Warmwasserbereitung. Da sie die erzeugte Wärme über einen Luftstrom in die Räume abgeben und zudem die Außenluft als Wärmequelle nutzen, spricht man hier auch von Luft-Luft-Wärmepumpen.
Die Anlagen können allein ganze Häuser heizen, aber auch einen bestehenden Öl- oder Gaskessel ergänzen. Soll ein ganzes Einfamilienhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpen ausgestattet werden, müssen die Eigentümer:innen mit Kosten von 12.000 bis 18.000 € rechnen. Eine Förderung gibt es für diese Anlagen nicht.
Vorteile:
-
Relativ niedrige Anschaffungskosten
-
Geringe laufende Kosten
-
Niedrige CO2-Emissionen
-
Effizienter Betrieb – vor allem, wenn die Abluft einer automatischen Lüftungsanlage als Wärmequelle genutzt wird
-
Anlagen lassen sich im Sommerhalbjahr für die Kühlung der Räume einsetzen
Nachteile:
-
Keine staatliche Förderung
-
Kann nur zur Raumheizung genutzt werden, weiterer Wärmeerzeuger wird zur Warmwasserbereitung benötigt
-
Wärme wird über einen Luftstrom in die Räume transportiert, was als störend empfunden werden kann
-
Anlagen geben ein leises Geräusch von sich
-
Hoher baulicher Aufwand bei der Installation: Bei Einzelraum-Anlagen muss für jeden Raum eine eigene Anlage an der Fassade installiert werden. Bei Mehrraum-Anlagen müssen im Innern des Hauses Rohrleitungen verlegt werden, durch die die Luft in die Räume gelangt
Infrarot-Heizungen
Infrarot-Heizungen senden elektromagnetische Wellen aus, die Körper und Gegenstände im Raum erwärmen. Diese Strahlungswärme empfinden Menschen als sehr angenehm. Die Technik ist in eine Platte integriert, die an die Wand gehängt wird. In kleineren Räumen genügt eine Infrarotheizung, in größeren sind mehrere nötig. Die Anlagen sind günstig, einzelne Platten kosten nur wenige hundert Euro. Der Bund fördert Infrarot-Heizungen nicht.
Um die elektromagnetischen Wellen zu erzeugen, brauchen Infrarotheizungen Strom – und das nicht zu knapp. Im Vergleich zu Wärmepumpen sind sie nämlich äußerst ineffizient. Sie verursachen also sehr hohe Stromkosten. Deshalb eignen sie sich nur für Passivhäuser und andere besonders energieeffiziente Gebäude, da deren Wärmebedarf minimal ist.
Vorteile:
-
Sehr geringe Investitionskosten
-
Wartungsfrei
-
Angenehme Wärme
-
Keine Heizungsanlage im Keller
Nachteile:
-
Stromkosten sind so hoch, dass die Technologie in Altbauten trotz der sehr geringen Anschaffungskosten in der Regel unwirtschaftlich ist
-
Montage in den Wohnräumen notwendig
Wer sich im Altbau bei der neuen Heizung für erneuerbare Energien entscheidet, kann von großzügigen staatlichen Förderungen profitieren. Aktuell gelten folgende Fördersätze:
-
Solarthermie: bis zu 70 % der Kosten
-
Biomasseheizungen: bis zu 70 % der Kosten plus pauschalen Zuschlag für besonders effiziente Anlagen
-
Wärmepumpen: bis zu 70 % der Kosten
-
Anschluss an ein Wärmenetz: bis zu 70 % der Kosten

Die neuen Fördersätze basieren auf der Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG). Der Standard-Zuschuss liegt bei 30 % der Kosten. Liegt das zu versteuernde Einkommen der Eigentümer:innen unter 40.000 €, übernimmt der Bund weitere 30 % der Kosten. Einen weiteren Bonus erhalten Eigentümer:innen selbst genutzter Immobilien für den Austausch von funktionstüchtigen Biomasse- und Gasheizungen, die älter als 20 Jahre sind. Wenn sie eine Öl-, Kohle-, Nachtspeicher- und Gasetagenheizung ersetzen, bekommen sie diesen Bonus sogar unabhängig vom Alter der Anlage. Bis 31. Dezember 2028 beträgt der Bonus 20 %, danach sinkt er alle zwei Jahre um drei Prozentpunkte.
Bei Berechnung der Förderhöhe werden nur Kosten bis zu einer Höhe von 30.000 € berücksichtigt. Hausbesitzer:innen erhalten also maximal 21.000 €. Detaillierte Informationen zur Förderung von Wärmepumpen finden Sie hier.
Gut zu wissen: Bei neuen Gasheizungen werden lediglich die zusätzlichen Kosten für die potenzielle Umrüstung auf Wasserstoff gefördert.
1. Vor-Ort-Begehung
Alte Heizungen verbrauchen oft mehr Energie als notwendig. Der erste Schritt auf dem Weg zu einer neuen Heizung sollte daher eine Beratung im Rahmen einer Vor-Ort-Begehung mit einer Energieberatung sein. Wer sich für einen individuellen Sanierungsfahrplan (iSFP) entscheidet, bekommt eine detaillierte Einschätzung mit Handlungsempfehlungen. Bis zu 80 % der Kosten für den iSFP werden staatlich gefördert.
2. Planung
Um eine neue Heizung perfekt auf den Altbau abzustimmen, muss der Energiebedarf des Hauses ermittelt werden. Dabei kommt unweigerlich die Dämmung auf den Prüfstand. Gut gedämmte Gebäudehüllen benötigen deutlich weniger Energie und ermöglichen eine sparsamere Heizungsanlage. Bevor eine moderne Heizung in ein älteres Gebäude kommt, macht es daher Sinn über mögliche Verbesserungen bei der Dämmung nachzudenken und entsprechende Maßnahmen zu planen.

Auch die Heizkörper bzw. Radiatoren sind wichtig, denn die von ihnen benötigte Vorlauftemperatur entscheidet darüber, ob eine Wärmepumpe zum Einsatz kommen kann. Besonders gut geeignet sind Fußbodenheizungen oder Flächenheizkörper. Diese benötigen eine geringe Vorlauftemperatur.
3. Installation
Die Heizungsinstallation selbst dauert bis zu vier Tagen – je nach System. Bei einer Wärmepumpe müssen Sie beispielsweise einen Tag für die Erdarbeiten, zwei Tage für die Installation und einen Tag für die Inbetriebnahme einplanen. Dabei sollte auch ein hydraulischer Abgleich erfolgen, um einen effizienten Betrieb zu gewährleisten. Wird die Heizung gefördert, ist dieser sogar vorgeschrieben.
Es lohnt sich, die Angebote mehrerer Fachbetriebe vorher zu vergleichen. Achten Sie darauf, dass der ausführende Betrieb bereits Erfahrungen mit der von Ihnen gewählten Heizungsart hat. Fachhandwerker für Wärmepumpen finden Sie beispielsweise über den Bundesverband Wärmepumpe e.V.
4. Betrieb
Wenn die Heizung erst einmal installiert ist, sollten Sie einmal pro Jahr in eine Wartung investieren. So können Sie einen einwandfreien Betrieb sichern und durch genaue Feinjustierung Energie im Altbau sparen. Bei Wärmepumpen sind regelmäßige Wartungen eine Bedingung für Garantieleistungen. Je nach System können Wartungen auch vorgeschrieben sein. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn mehr als drei Kilogramm Kältemittel verwendet werden. Bei Wasser-Wasser-Wärmepumpen ist die Überprüfung des Grundwasserbrunnens verpflichtend.
Wärme aus Luft,
Erde oder Wasser
Wärmepumpen sind eine lohnende Investition in zukunftsfähige Heizungssysteme. Doch welche Modelle gibt es und wie wird aus Luft, Wasser und Erde schlussendlich Wärme erzeugt? Ein Experte für Heiztechnik klärt alle wichtigen Fragen.
Kostenlose Online-Beratung

Fazit
Bald modernisieren und von Förderungen profitieren
Um eine Modernisierung der Heizungsanlage im Altbau kommt auf lange Sicht kein Immobilienbesitzer herum. Welches System die beste Heizung für ein altes Haus ist, lässt sich nicht allgemein beantworten. Fest steht: Vorausschauendes Handeln in puncto Heizung zahlt sich immer aus. Denn der Betrieb von Heizungen mit fossilen Brennstoffen wird stetig teurer – nicht zuletzt aufgrund des steigenden CO2-Preises. Wer sich bis 2028 für eine nachhaltige Heizlösung entscheidet, profitiert von höheren staatlichen Förderungen.

Unser Wärmepumpen-Komplettangebot
-
Individuell abgestimmte Beratung
-
Bei Eignung der Immobilie: individualisiertes Angebot zum Kauf einer Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Beispielrechnung zur Wirtschaftlichkeit
-
Hochmoderne Wärmepumpe von Vaillant
-
Exklusiver Förderservice für höchstmögliche Zuschüsse
-
Installation und Inbetriebnahme durch von Vattenfall ausgewählte Fachhandwerker:innen

Smarte Thermostate für die Fußbodenheizung
Smarte Thermostate helfen Ihnen, den Energieverbrauch beim Heizen zu optimieren. Über eine App können Sie bequem individuelle Heizpläne einrichten und diese an Ihre Bedürfnisse anpassen.
Andere spannende Artikel

Energetische Sanierung – Kosten und Förderungen
Mit ihr kann der Energieverbrauch eines Gebäudes signifikant gesenkt werden. Zum Wohle der Umwelt – und langfristig des Portemonnaies.

Wärmepumpe für den Altbau
Wärmepumpen sind energetische Allroundtalente: Sie können Räume heizen und kühlen und erwärmen nebenher noch das Brauchwasser. Aber welche Wärmepumpe ist besonders gut für den Altbau geeignet?
