So berechnen Sie den Stromverbrauch von Wärmepumpen
Zuletzt aktualisiert am 12.8.2025
Lesedauer: 7 Minuten
Wärmepumpen nutzen Umweltwärme zum Heizen. Dafür brauchen Sie Strom. Wenn die Voraussetzungen stimmen, setzt die nachhaltige Heiztechnik ein Vielfaches der eingesetzten Energie in Wärme um. Aber wie hoch ist der Stromverbrauch im laufenden Betrieb? Und wie lassen sich die Kosten berechnen und minimieren?
Inhalt dieser Seite
- Einflussfaktoren auf den Stromverbrauch
- Die Jahresarbeitszahl zeigt die Effizienz einer Wärmepumpe
- Stromverbrauch verschiedener Wärmepumpen-Arten
- So berechnen Sie die Stromkosten einer Wärmepumpe
- Stromverbrauch einer Wärmepumpe im Winter
- Lohnen sich Wärmepumpen-Stromtarife?
- Strom sparen beim Einsatz einer Wärmepumpe
So hoch sind die Stromkosten von Wärmepumpen
Die Stromkosten einer Wärmepumpe hängen von vielen Faktoren ab. Dazu zählen die zu beheizende Grundfläche ebenso wie die Dämmung des Hauses. Auf all das gehen wir im Folgenden genauer ein. Außerdem vergleichen wir die Kosten für den der Betrieb einer Wärmepumpe mit denen einer Gas- oder Ölheizung – aktuell und in der Zukunft.
Die Kosten für Öl und Gas werden zukünftig eher steigen. Das liegt nicht nur an der steigenden CO2- Steuer, sondern auch an der Verknappung der fossilen Brennstoffe. Die Stromkosten einer Wärmepumpe können Sie hingegen selbst beeinflussen, wenn Sie in Solartechnik investieren: Wer die Wärmepumpe mit Strom aus der eigenen PV-Anlage betreibt, profitiert von geringeren Stromkosten.
Für einen schnellen Vergleich der aktuellen Heizkosten gehen wir jedoch davon aus, dass Sie die Wärmepumpe mit Strom aus dem öffentlichen Netz betreiben.
Stromkosten am Beispielhaus
- 4-Personen Einfamilienhaus
- Baujahr 1999
- 150 Quadratmeter
Jährliche Heizkosten nach Heizungsart
(Standpunktbetrachtung vom 17.06.2025 für 12247 Berlin in den Vattenfall Tarifen Wärmepumpe Natur24 und Natur12 Gas ohne Boni bzw. Durchschnittspreis 2024 für Heizöl (Statista) inkl. sämtlicher Wartungskosten, aber exklusive der Anschaffungskosten.)
| Betriebskosten einer Gasheizung | Betriebskosten einer Ölheizung | Betriebskosten einer Wärmepumpe |
| Verbrauch 20.000 kWh Gas à 9,93 Cent + 190,80 € Grundpreis = 1.986 € +230 € Wartungs- und Schornsteinfegerkosten |
Verbrauch 1.800 l Heizöl à 99,04 Cent = 1.790 € + Wartungs- und Schornsteinfegerkosten: 260 € | 5.000 kWh Wärmepumpenstrom à 23,77 Cent + Grundpreis Wärmepumpenstrom 112,80 € + Wartungskosten: 360 € |
| 2.406, 80 € | 2.043 € | 1.661 € |
Die Wärmepumpe schneidet bei den jährlichen Stromkosten also am besten ab, vor allem, wenn man einen Wärmepumpen-Stromtarif nutzt. Auch die Agora-Studie „Durchbruch für die Wärmepumpe“ belegt, dass die Betriebskosten einer Wärmepumpe normalerweise unter denen einer Gasheizung liegen.
Betrachten wir nun, wie sich der Stromverbrauch einer Wärmepumpe genau berechnen lässt.
Einflussfaktoren auf den Stromverbrauch
Der Stromverbrauch einer Wärmepumpe hängt davon ab, wie effizient sie arbeiten kann. Eine wichtige Voraussetzung für den effizienten Betrieb ist eine optimierte Heizlast. Dieser Begriff beschreibt, wie viel Wärme dem Haus zugeführt werden muss, um die gewünschte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Die Heizlast wird in Watt pro Quadratmeter angegeben und hängt von mehreren Faktoren ab:

Raumgröße: Die zu beheizende Fläche spielt eine entscheidende Rolle für die Heizlast. Mehr Raum bedeutet mehr Energieaufwand für das Heizen, was den Stromverbrauch erhöht.
Dämmung: Je besser ein Gebäude gedämmt ist, desto weniger Wärme geht verloren. Die Heizung muss also nicht permanent auf Hochtouren laufen. Das ist energieeffizient und reduziert somit den Stromverbrauch.
Vorlauftemperatur: Der Vorlauf ist der Weg von der Heizung zum Heizkörper. Je nach Art des Heizkörpers werden unterschiedliche Vorlauftemperaturen benötigt, um die gewünschte Raumwärme zu erzielen: Großflächige Heizkörper können beispielsweise mit niedrigeren Vorlauftemperaturen arbeiten. Und je niedriger die Vorlauftemperatur im Heizsystem, desto niedriger ist der Stromverbrauch der Wärmepumpe.
Um die Energieeffizienz verschiedener Wärmepumpen zu vergleichen, gibt es die Jahresarbeitszahl (JAZ). Sie ist ein aussagekräftiger Indikator dafür, wie viel Wärme eine Wärmepumpe im Jahresdurchschnitt pro Einheit des eingesetzten Stroms erzeugt. Je höher die Jahresarbeitszahl, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe.
Ein Beispiel: Eine Jahresarbeitszahl von 4 bedeutet, dass eine Wärmepumpe für die Bereitstellung von 4 kWh Wärme durchschnittlich 1 kWh Strom benötigt (Verhältnis 1:4). Die restlichen 3 kWh werden aus der Umgebungswärme gewonnen. Wie hoch die JAZ konkret ausfällt, ist je nach Haus, Leistung und Art der Wärmepumpe unterschiedlich.


„Mit einer Wärmepumpe können Sie Ihre Energiekosten dauerhaft senken”
Wärmepumpen in Einfamilienhäusern können die Energiekosten gegenüber Heizungen mit fossilen Brennstoffen oft deutlich reduzieren. Mit guter Dämmung sowie günstigen Wärmepumpen-Stromtarifen aus erneuerbaren Energien lässt sich der Stromverbrauch von Wärmepumpen nochmals senken. Am effizientesten lässt sich die Wärmepumpe mit dem von der eigenen Photovoltaikanlage produzierten Strom betreiben.
Sie möchten wissen, wie hoch Ihr Einsparpotenzial ist? Nutzen Sie den Vattenfall-Eignungscheck.
Stromverbrauch verschiedener Wärmepumpen-Arten
Die Jahresarbeitszahl unterscheidet sich je nach Wärmepumpenart. In einem Feldprojekt der Agora-Studie von 2018/19 erreichten Luft-Wasser-Wärmepumpen durchschnittlich eine JAZ von 3,1, während Sole-Wasser-Wärmepumpen auf 4,1 kamen. Aktuelle Luft-Wasser-Wärmepumpen erreichen inzwischen eine Jahresarbeitszahl (JAZ) von 4, das bedeutet, dass sie im Jahresdurchschnitt pro KWh eingesetztem Strom 4 KWh Wärme erzeugen.
Auch wenn die Luft-Wasser-Wärmepumpe schlechter abschneiden sollte als die Sole-Wasser-Wärmepumpe, ist sie trotzdem oft die kostengünstigste Lösung – insbesondere bei der Nachrüstung im Bestand. Die Investitionskosten und der Aufwand beim Einbau sind bei der Luft-Wasser-Wärmepumpe nämlich deutlich niedriger als bei den anderen Wärmepumpen-Arten. Für Erdwärmepumpen und Wasser-Wasser-Wärmepumpen müssen umfangreiche Bodenarbeiten eingeplant werden. Die Luft-Wasser-Wärmepumpe wird hingegen einfach aufgestellt und mit der bestehenden Heizungsanlage verbunden.
So berechnen Sie die Stromkosten einer Luft-Wasser-Wärmepumpe
Da Luft-Wasser-Wärmepumpen sich ohne großen Aufwand kostengünstig in Bestandsgebäuden nachrüsten lassen, ist es nicht verwunderlich, dass sie am beliebtesten sind: Laut Bundesverband Wärmepumpe sind 87 % aller neu eingebauten Wärmepumpen Luft-Wasser-Wärmepumpe. Deswegen berechnen wir im Folgenden die Stromkosten am Beispiel einer Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Um die Stromkosten zu berechnen, benötigen Sie folgende Angaben:
-
Jährliche Heizstunden
-
Effizienz der Wärmepumpe (JAZ)
-
Heizleistung der Wärmepumpe (basierend auf Heizlast des Hauses) in kW
-
Kosten pro kWh Strom
1. Stromverbrauch berechnen
Bei den jährlichen Heizstunden gehen wir vom deutschen Durchschnittswert (2.000 Heizstunden pro Jahr) aus. Eine neu eingebaute Wärmpepumpe erreicht bei ausreichender Dämmung des Hauses aktuell im Regelfall eine JAZ von 4.
Gut zu wissen: Genau lässt sich die JAZ erst nach dem Einbau bestimmen. Wie effizient eine Wärmepumpe in Ihrem Haus arbeiten kann und welche Heizleistung Sie benötigen, erfahren Sie im Rahmen einer qualifizierten Wärmepumpen-Beratung mit Vor-Ort-Begehung.
Rechenbeispiel für ein 4-Personen-Einfamilienhaus:
-
Wohnfläche: 150 Quadratmeter
-
Benötigte Heizleistung: 10 kW
-
JAZ der Wärmepumpe: 4
-
Jährliche Heizstunden: 2.000
Voraussichtlicher Stromverbrauch der Wärmepumpe:
10 kW/JAZ 4 x 2.000 Heizstunden = 5.000 kWh Stromverbrauch/Jahr

2. Stromkosten berechnen
Die Stromkosten für die Wärmepumpe sind abhängig vom Strompreis und Ihrem individuellen Stromtarif. Ein Beispiel für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 5.000 kWh Stromverbrauch/Jahr:
|
10,90 € Grundpreis/Monat |
130,80 € |
|
33,97 Cent/kWh x 5.000 kWh |
+ 1.698,50 € |
|
Jährlicher Gesamtpreis |
= 1829,30 € |
Sie möchten es ganz genau wissen?
Rechnen Sie selber nach. Mit dem Kostenplaner. Erfahren Sie, ob sich eine Luft-Wasser-Wärmepumpe für Ihr Haus rechnet:
-
Gesamtkosten im Blick: Alle Kosten im Detail erklärt inkl. 2 echter Beispiele (Öl und Gas)
-
Max. Förderung: Was, wie, von wem gefördert wird und wie Sie die höchsten Summen sichern
-
Stromkosten berechnen: Einfache Anleitung zur Berechnung Ihrer Betriebskosten mit Wärmepumpe
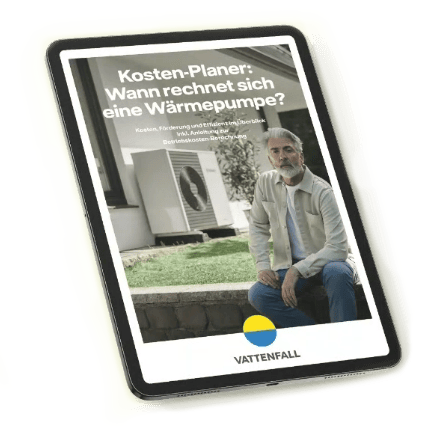
Stromverbrauch einer Wärmepumpe pro Tag im Winter
Der tägliche Stromverbrauch einer Wärmepumpe lässt sich wie folgt berechnen: Bei einem Stromverbrauch von 5.000 kWh/Jahr liegt der durchschnittliche tägliche Stromverbrauch bei 13,7 kW. Natürlich verbraucht die Wärmepumpe im Sommer weniger Strom als im Winter. Im Sommer stellt sie nur Warmwasser bereit. Im Winter muss sie auch das Haus heizen.
Wie viel Strom sie für das Heizen der Räume im Haus verbraucht, hängt nicht nur von den Raumgrößen und der Dämmung, sondern auch von der Außentemperatur ab. Wenn die Außentemperatur 0 Grad beträgt, benötigt eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mehr Energie, um das Wasser im Heizkreislauf auf die gewünschte Vorlauftemperatur zu erwärmen als bei +15 Grad.
Beispiel: Standpunktbetrachtung vom 17.06.2025 für 12247 Berlin im Tarif Wärmepumpe Natur24.
|
9,40 € Grundpreis/Monat |
112,80 € |
|
23,37 €/kWh x 5.000 kWh |
+ 1.168,50 € |
|
Jährlicher Gesamtpreis |
= 1281,30 € |
Das entspricht einer Ersparnis von 548 € gegenüber dem regulären ÖkoStrom-Tarif. Allerdings müssen für die Nutzung eines Wärmepumpen-Stromtarifs bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden, die zu Mehrkosten führen können.


Voraussetzungen für den Bezug von Wärmepumpenstrom
Wenn Sie einen speziellen Wärmepumpen-Stromtarif nutzen möchten, ist der Einbau eines separaten Stromzählers durch Ihren Messstellenbetreiber notwendig. Teilweise muss hierfür der Zählerschrank erneuert werden, was zu zusätzlichen Kosten führen kann.
Den zusätzlichen Zähler brauchen Sie nicht anzumelden. Lediglich die Wärmepumpe selbst muss beim Netzbetreiber angemeldet werden. Das übernimmt aber der Elektrofachbetrieb, der die Wärmepumpe bei Ihnen einbaut.
So sparen Sie Strom beim Einsatz einer Wärmepumpe
Damit eine Wärmepumpe effizienter arbeiten kann und noch weniger Stromkosten verursacht, gibt es mehrere Möglichkeiten. Bei älteren Gebäuden hilft eine energetische Sanierung den Energiebedarf eines Gebäudes zu senken. Zu den wichtigsten Maßnahmen zählen die Dämmung des Gebäudes, aber auch der Einbau moderner Heiztechnik. Der Staat fördert diese Investition in die Zukunft Ihrer Immobilie mit Zuschüssen im Rahmen des individuellen Sanierungsfahrplans. Erster Schritt auf dem Weg zur energetischen Sanierung ist eine Bestandsaufnahme des Ist-Zustands bei einer Energieberatung. Auch dafür übernimmt der Staat den Großteil der Kosten.
Bei jüngeren Gebäuden (ab Baujahr 2002) ist der Energiebedarf bereits geringer. Aber auch hier können Sie Stromsparen beim Einsatz einer Wärmepumpe, beispielsweise durch einen hydraulischen Abgleich. Dabei wird der Durchfluss des Heizungswasser genau auf die Heizlast des Hauses angepasst.
Neben der Heizlast spielt auch der Warmwasserverbrauch eine Rolle für den Stromverbrauch einer Wärmepumpe. Dabei gilt als Faustregel: Je mehr Menschen in einem Haus leben, umso höher ist auch der Verbrauch an Warmwasser durch die Nutzung von Badewannen oder Duschen.
Natürlich ist auch die individuelle Wohlfühltemperatur ein Kostenfaktor: Wer die Raumtemperatur nur um ein Grad verringert, verbraucht 2 bis 5 % weniger Energie.
Um Stromkosten zu sparen ist auch die Kombination von Wärmepumpe und Photovoltaikanlage eine gute Lösung. So können Sie den Strom für die Wärmepumpe selbst erzeugen – das ist nicht nur günstiger als Strom aus dem Netz, sondern auch nachhaltig.

Fazit
Wärmepumpen können die Heizkosten senken
Der Stromverbrauch einer Wärmepumpe hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Der energetische Zustand des Hauses gehört genauso dazu wie das individuelle Verbrauchsverhalten. Trotzdem liegen die Stromkosten in der Regel unter den Betriebskosten für eine Gas- oder Ölheizung. Noch mehr Informationen zu den Kosten einer Luft-Wasser-Wärmepumpe erhalten Sie in unserem kostenlosen Kosten-Planer für Wärmepumpen (PDF).

Unser Wärmepumpen-Komplettangebot
-
Individuell abgestimmte Beratung
-
Bei Eignung der Immobilie: individualisiertes Angebot zum Kauf einer Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Beispielrechnung zur Wirtschaftlichkeit
-
Hochmoderne Wärmepumpe von Vaillant
-
Exklusiver Förderservice für höchstmögliche Zuschüsse
-
Installation und Inbetriebnahme durch von Vattenfall ausgewählte Fachhandwerker:innen
Unsere innovativen Energielösungen
Wärmepumpenstrom
Effizient und umweltfreundlich heizen mit erneuerbarer Energie: Mit einer Wärmepumpe starten Sie in eine nachhaltige Zukunft – und sparen langfristig Energiekosten.
Zum Wärmepumpen-Tarif
Ökostrom
Unser Ökostrom besteht zu 100 % aus erneuerbaren Energien. Wir fördern zu fairen Preisen den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen – mit Ihrer Hilfe.
Zum Ökostrom-Tarif
Solarlösungen
Mit einer eigenen Photovoltaikanlage können Sie Ihr Zuhause mit selbst erzeugtem Solarstrom versorgen. Gemeinsam finden wir die passende Solarlösung für Ihr Zuhause.
Zu den Solarlösungen
Andere spannende Artikel

Wärmepumpe: Funktion & Aufbau
Wärmepumpen nutzen die Wärme von Luft, Grundwasser oder dem Erdboden zum Heizen oder Kühlen von Gebäuden. Da sie die Umweltwärme nutzbar machen, sind sie ein nachhaltiges Heizsystem mit enormem Zukunftspotenzial.

Förderung für die Wärmepumpe
Wärmepumpen heizen umweltfreundlich und werden vom Staat gefördert. Die Bundesförderung für effiziente Gebäude – kurz BEG – wurde im Januar 2024 reformiert. Wir informieren Sie über die aktuellen und geplanten Regelungen.
