Die Rolle der Verteilnetzbetreiber in der Energiewende
Produktionshallen, Serverräume, Ladestationen und Bürogebäude: Rund 880 Verteilnetzbetreiber in Deutschland sorgen dafür, dass Energie aus Wind, Sonne oder Biomasse zuverlässig bis in jedes Gewerbegebiet und Industriezentrum gelangt. Ohne diese Verteilnetze, die Strom aus erneuerbaren Quellen sicher und stabil zu Unternehmen und Verbraucher:innen bringen, bleibt die Energiewende reine Theorie. In diesem Artikel finden Sie die wichtigsten Informationen darüber, wie Verteilnetzbetreiber arbeiten, welche Herausforderungen sie aktuell meistern müssen – und was das für Unternehmen bedeutet.
Verteilnetzbetreiber (VNB) übernehmen die Verteilung von Strom aus dem Hochspannungsnetz bis in Betriebe, Wohnhäuser und öffentliche Einrichtungen. Sie betreiben rund 1.679.000 Kilometer Leitungen im Mittel- und Niederspannungsbereich und bilden damit das Rückgrat der Stromversorgung direkt vor Ort.
In Deutschland sind 866 VNB aktiv (Stand 2024). Diese sind meist regional organisiert und tragen Verantwortung für Netzanschlüsse, Einspeisung erneuerbarer Energien, Betriebssicherheit und Netzausbau. Zu den größten gehören die E.ON-Tochtergesellschaften wie Westnetz, Avacon, Bayernwerk oder HanseWerk, die zusammen rund 23 % Marktanteil abdecken.
Im Unterschied zu den vier Übertragungsnetzbetreibern, die den Ferntransport über Höchstspannungsleitungen übernehmen, sind VNB auf die Versorgungssicherheit im lokalen Raum spezialisiert. Netzstruktur, Kapazität und Ausbaubedarf unterscheiden sich dabei je nach Region – nach Bevölkerungsdichte, Netzinfrastruktur und Anteil erneuerbarer Energien.
Welche Netze zählen zu den Verteilnetzen?
Stromnetze sind mehrstufig organisiert: Das überregionale Verbundnetz verbindet Erzeugung, Transport und Verteilung über Landesgrenzen hinweg und sorgt für Versorgungssicherheit im europäischen Strommarkt. Es umfasst das Übertragungsnetz auf Höchstspannungsebene sowie die daran angeschlossenen Verteilnetze, die Strom regional weiterleiten. Daneben gibt es sogenannte Inselnetze – unabhängige, autark betriebene Systeme, die etwa in Industrieanlagen, Gebäuden mit hoher Eigenversorgung oder auf abgelegenen Inseln eingesetzt werden.
Netze im Verteilnetz
Das Verteilnetz ist der Teil des Stromnetzes, der Strom aus dem Übertragungsnetz aufnimmt und über Mittel- und Niederspannung an Verbraucher verteilt. Verteilnetze umfassen also alle Stromleitungen, die unterhalb der Hochspannungsebene liegen – also Mittelspannung und Niederspannung, in einigen Regionen auch 110-kV-Hochspannung, sofern sie nicht bereits zum Übertragungsnetz gehören.
Niederspannungsnetze (bis 1 kV) bringen Strom bis an den Hausanschluss – relevant für kleinere Unternehmen, Büros und Ladeinfrastruktur.
Mittelspannungsnetze (10–30 kV) verbinden Umspannwerke mit Gewerbegebieten, Ortsnetzstationen oder größeren Verbrauchern. Für viele Industrie- und Handwerksbetriebe ist das die direkte Versorgungsebene.
Hochspannungsnetze (60–110 kV) gehören in einigen Regionen zum Verteilnetz. Das ist vor allem in Flächenländern wie Bayern oder Niedersachsen der Fall, wo Übertragungs- und Verteilnetz technisch ineinander übergehen.
Für Unternehmen besonders relevant: Die Kosten für den Stromnetzanschluss und -transport, also die Netzentgelte, hängen stark von der regionalen Netzstruktur ab. In dünn besiedelten Regionen mit hohem Erneuerbaren-Anteil und geringem Verbrauch steigen die Anforderungen an das Netz. Damit steigen häufig auch die Netzentgelte. Wer frühzeitig mit dem Netzbetreiber plant, kann unnötige Verzögerungen und Kosten vermeiden. Mehr Infos hier: Netzentgelte 2025.
Praxisbeispiel Anschlusskosten für PV-Anlage und Ladeinfrastruktur
Beispiel: Ein Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern plant eine PV-Anlage mit 300 kWp und vier Ladesäulen für E-Nutzfahrzeuge. Der örtliche Verteilnetzbetreiber kommuniziert, dass das bestehende Mittelspannungsnetz ausgelastet ist. Für den Anschluss sind Tiefbauarbeiten und ein Trafo-Ausbau notwendig, die Kosten belaufen sich laut aktuellen Erfahrungsberichten auf den Portalen Checkfox und Photvoltaik.one auf etwa 80.000 Euro, die Umsetzungszeit beträgt voraussichtlich 12 bis 18 Monate.
Zum Vergleich: Ein ähnlich aufgestellter Betrieb in einem Gewerbegebiet bei Nürnberg erhält laut Angaben des Netzbetreibers N-Ergie Netz für ein nahezu identisches Vorhaben ein Netzanschlussangebot binnen sechs Wochen, inklusive Umsetzung innerhalb von vier Monaten und deutlich geringeren Anschlusskosten im Bereich von 20.000 bis 30.000 Euro.
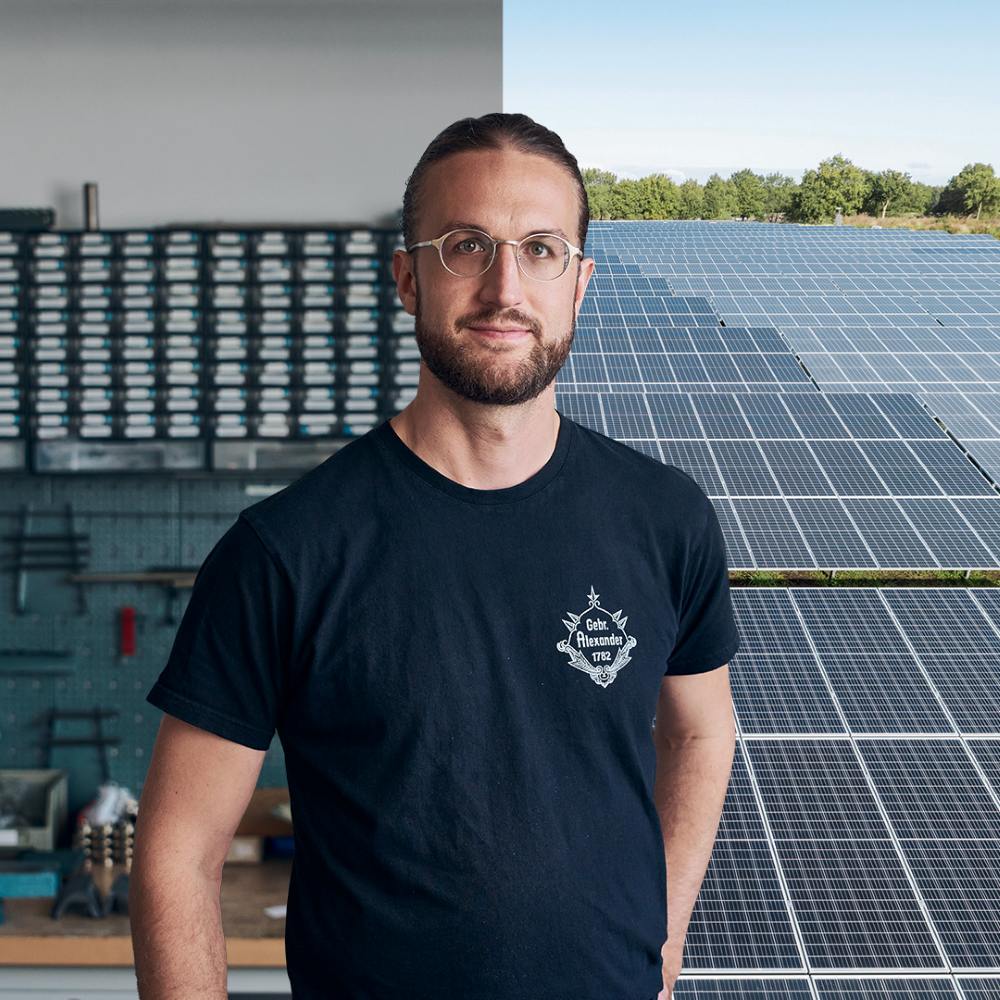
Sonnenenergie für Ihr Unternehmen
Profitieren Sie von unserer maßgeschneiderten Komplettlösung für Ihre Solaranlage:
- persönliche, kostenlose Beratung
- individuelle Planung bei Ihnen vor Ort
- fachgerechte Montage & zuverlässiger Support
Netzanschlüsse ermöglichen: Ob PV-Anlage, Wärmepumpe oder Ladeinfrastruktur – der VNB prüft Anschlussmöglichkeiten und stellt die technische Anbindung sicher, meist auf Mittel- oder Niederspannungsebene.
Netze ausbauen und verstärken: Neue Erzeugungsanlagen und Großverbraucher (z. B. Gewerbeparks oder Rechenzentren) erfordern zusätzliche Kapazitäten. VNB planen und realisieren entsprechende Ausbaumaßnahmen.
Versorgungssicherheit gewährleisten: Der Netzbetrieb folgt dem (n-1)-Prinzip. Fällt ein Leitungsstrang aus, bleibt die Stromversorgung über alternative Pfade stabil. Ein wichtiger Faktor für Unternehmen mit sensiblen Prozessen. Das (n-1)-Prinzip ist ein Sicherheitsstandard im Netzbetrieb, der in Stromnetzen, insbesondere bei Übertragungs- und Verteilnetzbetreibern, angewendet wird, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.
Netze intelligent betreiben: Verteilnetzbetreiber sind gefordert, ihre Netze durch Digitalisierung, Automatisierung und vorausschauende Wartung effizienter und widerstandsfähiger zu machen. Intelligentes Lastmanagement hilft dabei, Engpässe frühzeitig zu erkennen und gezielt zu vermeiden.
Investitionen auf Rekordniveau
Das deutsche Verteilnetz dient als infrastrukturelle Basis für die Energiewende. Daher wird es derzeit umfassend modernisiert. Netzbetreiber wie Netze BW und E.ON investieren in großem Umfang in neue Leitungen, Umspannwerke und digitale Steuerungstechnik. Netze BW plant bis 2045 bis zu 90 % ihrer Hochspannungsanlagen zu erneuern sowie rund 40.000 km Leitungen im Mittel- und Niederspannungsbereich auszubauen. Green Forum meldete im Herbst 2023 den Anschluss der einmillionsten Erneuerbare-Energien-Anlage, mit steigender Tendenz. Diese Ausbaupläne zeigen, wie tiefgreifend der Wandel im Verteilnetz ist.
Wo das Netz an Grenzen stößt
Mit dem Ausbau dezentraler Energieerzeugung und der zunehmenden Elektrifizierung von Mobilität und Wärme steigt auch die Belastung der Netze. In Regionen wie Ostdeutschland, wo deutlich mehr Strom eingespeist als verbraucht wird, fehlen leistungsfähige Abfuhrkapazitäten. Gleichzeitig führt der Ausbau von Ladeinfrastruktur, Wärmepumpen und industriellen Großverbrauchern zu lokalen Überlastungen, insbesondere im Niederspannungsbereich. Hinzu kommen lange Genehmigungsverfahren und weltweite Lieferengpässe bei technischen Komponenten. Herausforderungen, die den aktuellen Stand und die Weiterentwicklung des Verteilnetzes prägen.
Ziel der nationalen Netzstrategie ist es, den wachsenden Anforderungen mit effizienten Mitteln zu begegnen. Grundlage ist das sogenannte NOVA-Prinzip, das verbindlich im Netzentwicklungsplan Strom (NEP) angewendet wird.
NOVA = Netz-Optimierung vor Verstärkung vor Ausbau
Das Prinzip folgt den in § 1 EnWG festgelegten Zielen wie Effizienz, Umweltverträglichkeit und Versorgungssicherheit, wie das Bundesamt für Justiz bekannt gibt.
Was bedeutet das konkret?
Bevor eine neue Leitung gebaut wird, muss der Netzbetreiber prüfen, ob das bestehende Netz durch technische Maßnahmen ausreichend ertüchtigt werden kann, zum Beispiel durch leistungsstärkere Leitungen, smartere Steuerung oder Trafotausch.
Europas Stromnetz und Pläne für die Energiewende
Das europäische Verbundnetz verbindet nationale Strommärkte und ermöglicht den grenzüberschreitenden Austausch. Das wird gesteuert von Übertragungsnetzbetreibern und Verteilnetzbetreibern, die zunehmend koordiniert zusammenarbeiten.
Auf europäischer Ebene arbeitet die DSO Entity, die zentrale Stimme der Verteilnetzbetreiber in der EU, an gemeinsamen Standards für Netzbetrieb, Datenzugang und technische Schnittstellen. Grundlage dafür sind Leitlinien der EU-Kommission aus dem Jahr 2024, nach denen alle Mitgliedstaaten bis Juli 2025 nationale Umsetzungsberichte einreichen müssen. Projekte wie das „JWG Data Interoperability Repository“ bündeln diese Berichte sowie Referenzmodelle und technische Spezifikationen und werden laufend aktualisiert. So können Netz- und Anlagendaten sicher, transparent und interoperabel ausgetauscht werden. Das stärkt auch grenzüberschreitende Geschäftsmodelle und neue Beteiligungsformen.
Fazit: Die Verteilnetze sind das Rückgrat Ihrer Energielösung
Ein stabiles, modernes Verteilnetz ist Voraussetzung für nahezu jede Energieinvestition. Wer bei einem Netzneuanschluss oder einer Netzanpassung früh plant, vorausschauend mit dem Netzbetreiber kooperiert und technische Möglichkeiten ausschöpft, profitiert doppelt: durch Versorgungssicherheit und geringere Anschlusskosten.

Ihr Unternehmen, unsere Energie
Zuverlässig, fair, zukunftsorientiert: Vattenfall versorgt Unternehmen jeder Größe und Branche mit Energie. Entdecken Sie jetzt unsere vielfältigen Lösungen.
Das könnte Sie ebenfalls interessieren

CO2-Management im Test
In diesem Kurzinterview erklärt uns Christian Seiffert von der Schelchen GmbH, warum das Unternehmen CO2 misst und was es ihnen bringt.

Net Zero verstehen und umsetzen
Was bedeuten Netto-Null-Emissionen ganz allgemein und spezifisch für Ihr Unternehmen? Alle Fakten und Beispiele, die Sie brauchen.
Die Emissionsfaktoren für die CO2-Bilanz erklärt
Lesen Sie hier, wie Ihre CO2-Emissionen messbar und vergleichbar werden. So gelingt nachhaltiges Wirtschaften.
Ladestationen einfach gefördert
Die wichtigsten Tipps, damit Ihr Unternehmen maximal von der Förderung für E-Mobilität profitiert.
Was bedeutet ESG für Unternehmen?
Das Finanzmarkt-Tool ESG dient zur Bewertung von Nachhaltigkeit und Risiken in Unternehmen.
Nachhaltigkeit berichten mit VSME
Erfüllen Sie CSRD-Anforderungen, stärken Sie die Wettbewerbsfähigkeit und erhöhen Sie Transparenz.
Jetzt Newsletter abonnieren
5 Minuten für Unternehmen – Kostenloses Expertenwissen
✓ Monatliche Updates – kompakt aufbereitet
✓ Ausgewählte Fachartikel zu Energie & Business
✓ Branchenspezifische Interviews




